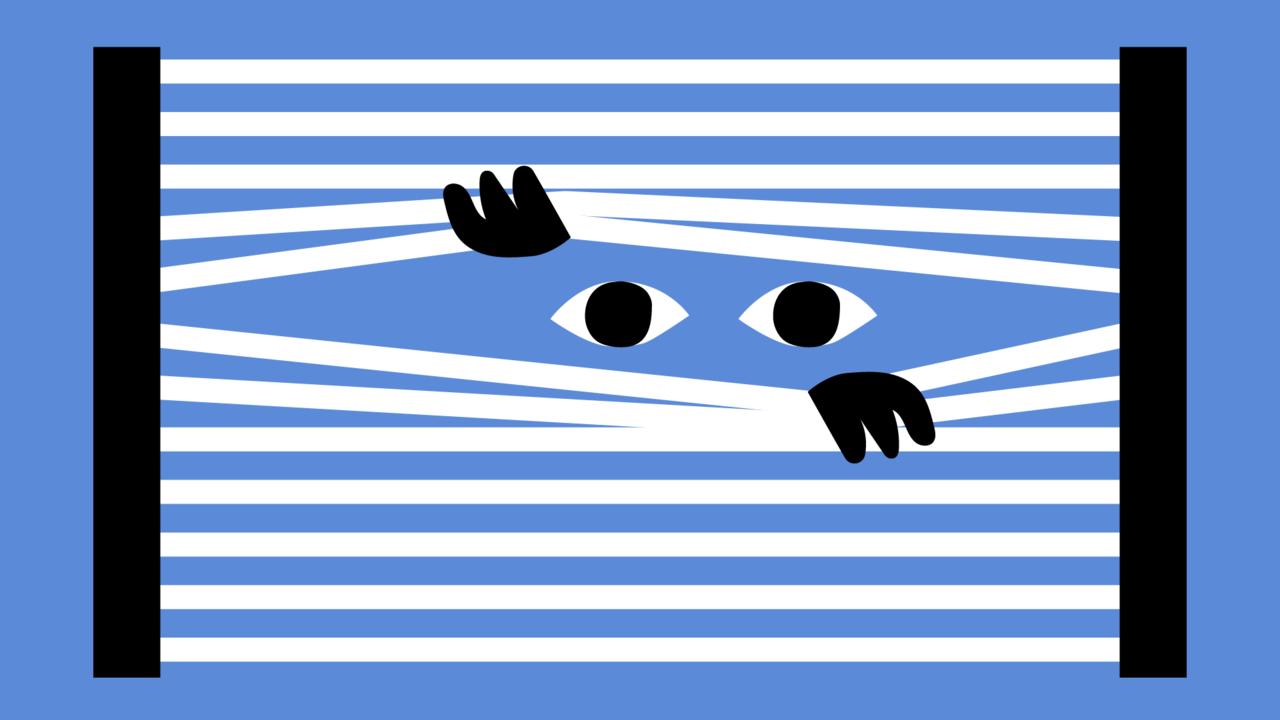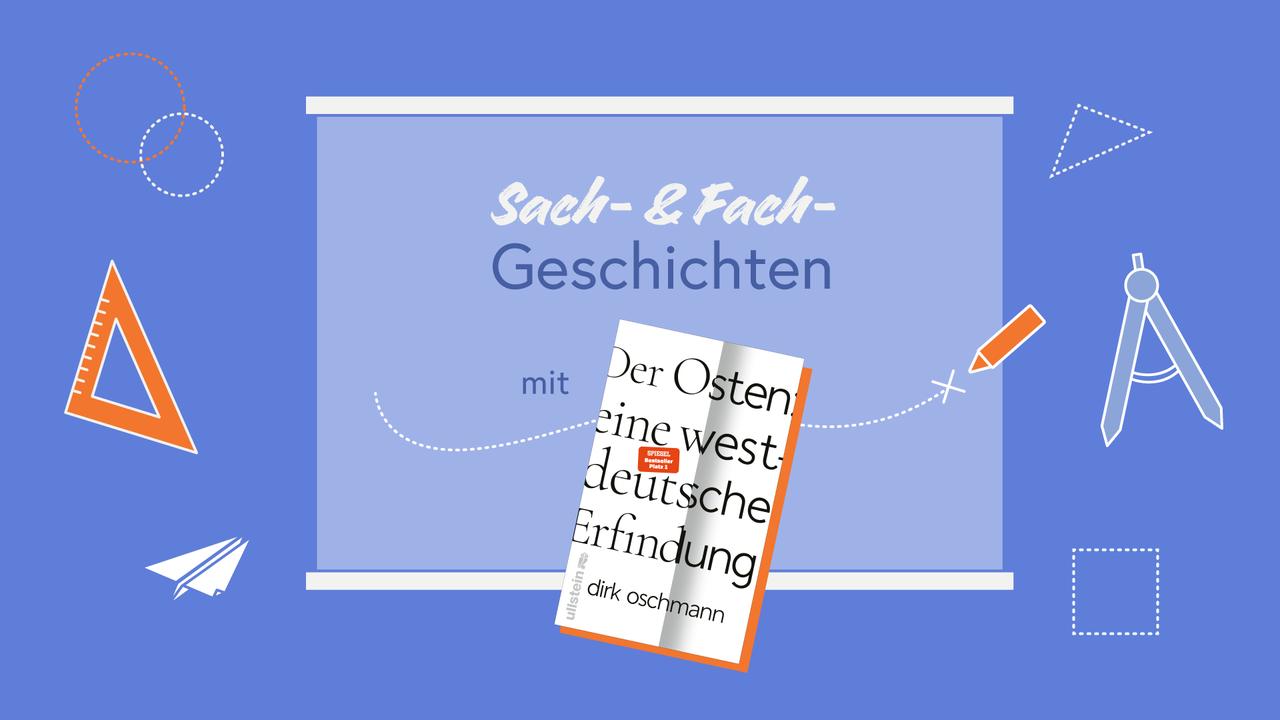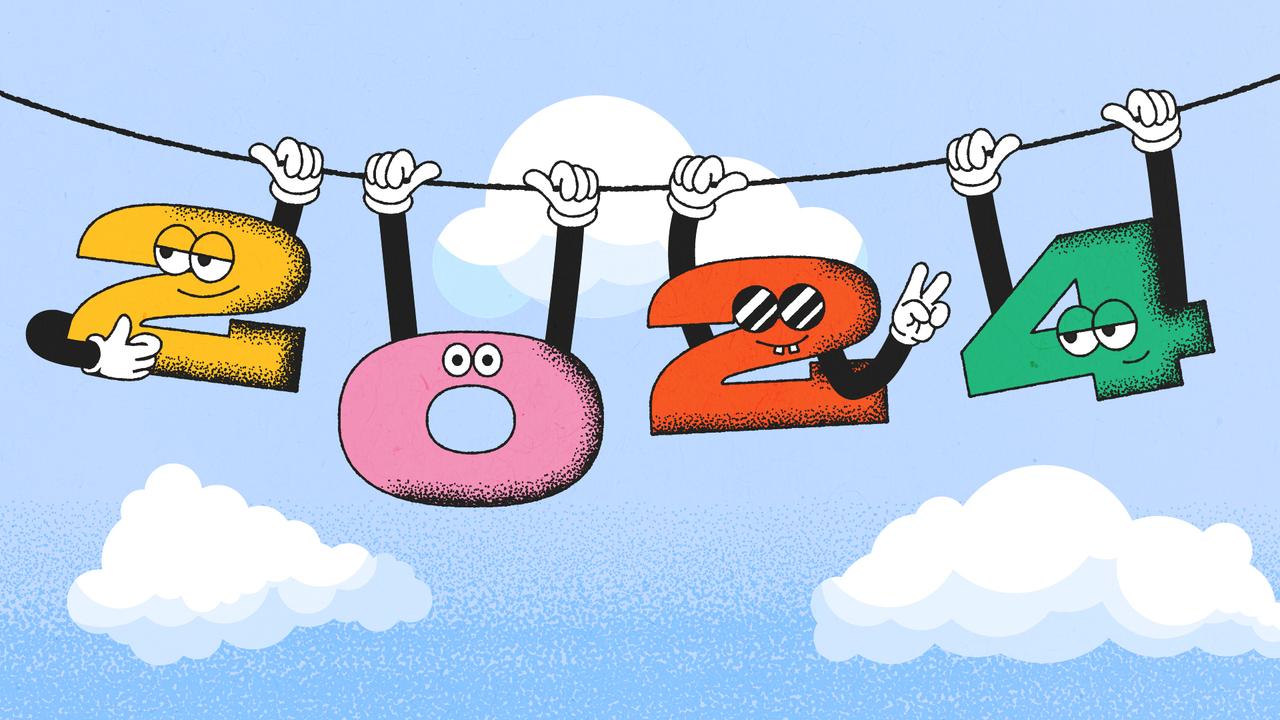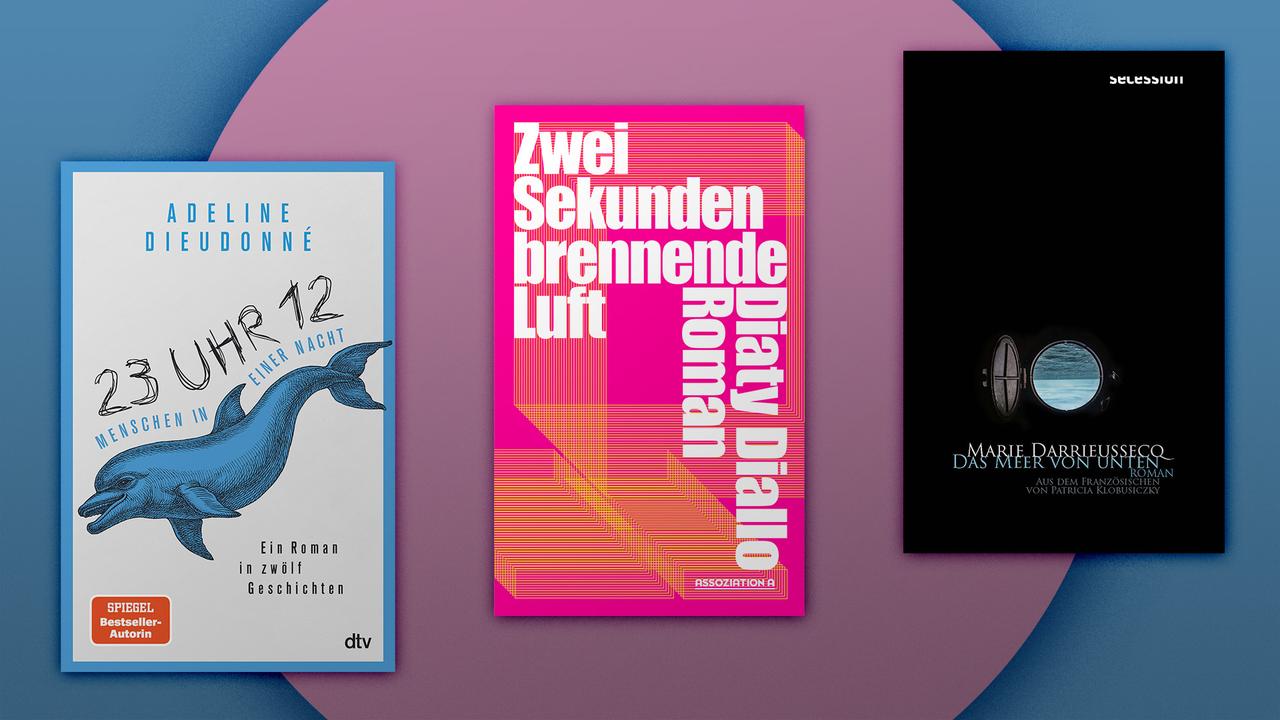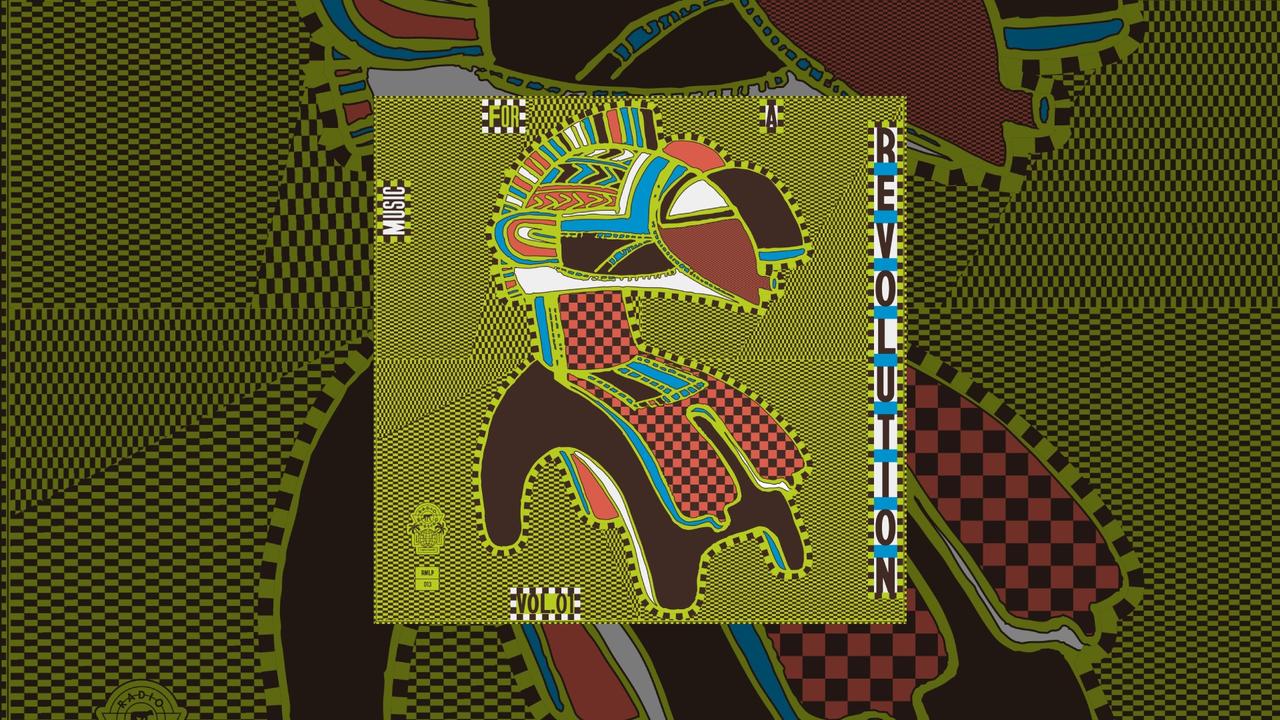Unsere Daten sollen uns allen gehörenUnderstanding Digital Surveillance Capitalism | Teil 6
17.7.2025 • Gesellschaft – Text: Timo Daum, Illustration: Susann Massute
Zum Abschluss seiner sechsteiligen Serie plädiert Timo Daum für eine Überwindung des Überwachungskapitalismus nach vorne, sprich für die Vergesellschaftung von Überwachung. Was das genau heißen soll? Happy season finale reading.
Der Überwachungskapitalismus ist kein normaler Kapitalismus, der zusätzlich auch noch überwacht und daher die Demokratie gefährdet, wie die Schöpferin des Begriffs, Shoshanna Zuboff, meint. Sondern eine Verwertungsmaschine, eine kapitalistische Profitmaschine, nur eben eine der neuesten, vorerst letzten Ausbeutungsmaschinen in der lange Reihe an solchen in der Geschichte des Kapitalismus (siehe Teil 3). Denn wie die Harvard-Ökonomin ganz richtig feststellt, liefern wir dieser Maschine „Mehrverhalten“ ganz analog zur „Mehrarbeit“ der Proletarierinnen und Proletarier in der kapitalistischen Fabrik. Anders ausgedrückt: Überwachung ist eine Produktivkraft und eine Ausbeutungspraxis zugleich.
Automatisierung der Überwachung
Die Entwicklung der Produktivkraft im Zusammenhang mit digitalen Technologien führt auch dazu, dass Überwachung und Datensammlung heute weitgehend automatisiert und quasi automatisch geschehen. War Überwachung in analogen Zeiten noch eher mühsame Handarbeit, hat uns die Digitalisierung auch in diesem Bereich Automatisierung beschert. Big Data fällt quasi automatisch an, ist ein Abfallprodukt jeglicher menschlicher aber auch maschineller Aktivität. Immer wenn sich irgendwas bewegt, Mensch oder Maschine, fließt der Datenstrom – und er fließt nur in eine Richtung. Wir sind die Datenquellen, einige weniger Gatekeeper sind die Datensenken.
Der Konsument ist der Überwachungsarbeiter
Um in der Analogie zu bleiben: So wie der Lieferant des Mehrwerts in den Fabriken, also der sich ausbeuten lassende Proletarier, zusammen mit diesen erst in einem – oft gewaltvollen Prozess – quasi erzeugt werden musste (durch Vertreibung und Abschneiden von alternativen Einkommensquellen), so musste der Lieferant des Mehrverhaltens auf den Plattformen, also das daten-ausbeutbare „Nutzeriat“, zusammen mit jenen erst in einem meist nicht so gewaltvollen Prozess erzeugt werden. Das Herr der Nutzerinnen und Nutzer musste auch erst generiert werden, damit seine rastlose Unruhe auch ausgebeutet werden kann. Woher er oder sie kommt, ob er oder sie selbst ein Abfallprodukt der kapitalistischen Selbstbewegung ist oder erst „erfunden“ und gepäppelt werden musste, ist zweitrangig. Guy Debord schreibt in Die Gesellschaft des Spektakels über diese Entdeckung:
„Während in der ursprünglichen Phase der kapitalistischen Akkumulation »die Nationalökonomie den Proletarier nur als Arbeiter betrachtet«, der das zur Erhaltung seiner Arbeitskraft unentbehrliche Minimum bekommen muß, ohne ihn jemals »in seiner arbeitslosen Zeit, als Mensch« zu betrachten, kehrt sich diese Denkweise der herrschenden Klasse um, sobald der in der Warenproduktion erreichte Überflußgrad vom Arbeiter einen Überschuß an Kollaboration erfordert. Urplötzlich von der vollständigen Verachtung reingewaschen, die ihm alle Organisations- und Überwachungsbedingungen der Produktion deutlich beweisen, findet dieser Arbeiter sich jeden Tag außerhalb dieser Produktion, in der Verkleidung des Konsumenten, mit überaus zuvorkommender Höflichkeit scheinbar wie ein Erwachsener behandelt."
Unterm Strich hat das Kapital „den Konsumenten“ geformt – und damit einen Typus, der für das Prosperieren des Kapitalismus wohl ebenso wichtig war und ist, wie der Typus des Arbeiters. In Debords Analyse ist dies das – zweifelhafte – Hauptverdienst der 68er-Revolution, nämlich dass sie den individualistischen Konsumenten aus der Taufe gehoben hat.
Abb: Der Begriff "privacy" nimmt in der englischsprachigen Literatur erst ab den 1960er-Jahren richtig Fahrt auf.
Freie Entscheidung
Ganz analog zum Lohnarbeiter und der Lohnarbeiterin, die aus freien Stücken einen Arbeitsvertrag eingehen, erkennen die überwachungskapitalistischen Instanzen den User oder die Userin als frei und gleich an. Auch sie werden auf den Überwachungsplattformen stets höflich gebeten, doch einzutreten in die umzäunten Gärten, die mit allerlei Versprechen nach Teilhabe und Genuss locken. Nur eine kleine Unterschrift, ein simpler Klick und schon öffnet sich die Tür zur Zauberwelt! Hier wird niemand gezwungen.
Diese Freiheit ist natürlich eine trügerische. Ähnlich wie es laut Bertolt Brecht Armen wie Reichen gleichermaßen untersagt ist, unter Brücken zu schlafen, ist es auch Armen wie Reichen überlassen, ob sie Datenlieferungen zustimmen wollen oder nicht. Niemand „muss“ eine Mietwohnung anmieten und dem Vermieter Einkommensnachweise liefern. Niemand „muss“ Grundsicherung oder Asyl beantragen und die damit verbundene Zustimmung zum Einblick in private Details. Der de facto doch erzwungenen Bereitschaft von Mietinteressent:innen, ihre Finanzdaten herzugeben, steht übrigens keine reziproke Offenlegung auf Seiten der Vermietenden gegenüber. Wer für Lieferando fährt, kann sein Einverständnis zur App-Nutzung nicht verweigern, so wie die Demokratie bekanntlich am Werkstor endet. Privacy ist ein Recht, aber man muss sie sich leisten können.
Die Verweigerungshaltung
Die übliche Reaktion auf die Datenausbeutung changiert zwischen achselzuckendem Akzeptieren derselben und vereinzelten individuellen Mikroverweigerungen. Die Haltung der individuellen Mikroverweigerung – ich bin nicht bei Facebook, ich lasse nur notwendige Cookies zu, ich benutze nicht Google, sondern eine andere Suchmaschine, Open Street Maps geht doch auch, ich nutze Firefox statt Chrome, ich kaufe meine Zugtickets am Schalter, nicht mit der App usw. – stellt letztlich verzweifelte Versuche dar, sich der omnipräsenten Maschine zu entziehen. So legitim eine solche Haltung auch sein mag, so nachvollziehbar jene Versuche, sich dem Überwachungsverhältnis zu entziehen, kann es doch keine individuelle Lösung für ein gesellschaftliches Problem geben. Die Parallele zum ökologischen Fußabdruck drängt sich auf, mit der doch von der Verantwortung von Unternehmen abgelenkt werden soll und die Verantwortung für den Klimawandel auf die Supermarktkunden abgewälzt werden soll.
Quantified Self
Bevor die Digitalkonzerne uns gemessen und vermessen, katalogisiert und datafiziert haben, trat eine kleine Gruppe an, dies erstmalig an sich selbst zu exerzieren. Wie Deborah Lupton gezeigt hat, begann die Quantified-Self-Bewegung zunächst lustvoll, sich mit den eigenen Daten zu beschäftigen und darüber in einen spielerischen Austausch mit anderen zu treten. Erst später übernahm die Tech-Branche mit ihrer Parole „10.000 Schritte sollst Du gehen und Dich mit anderen vergleichen!“ in großem Maßstab das Konzept. Quantified Self war also zunächst gar keine Ausbeutungs- und Überwachungsangelegenheit. Und es stellt sich die Frage, ob wir seine Kolonisierung durch Big Tech beantworten, indem wir das Ganze canceln – oder ob wir eben diese private Aneignung rückgängig und daraus eine wirklich kollektive Aktion machen.
Überwachung als Produktivkraft: Quantified AllOfUs
Wäre Karl Marx heute noch am Leben, würde er den Überwachungskapitalismus vermutlich ähnlich betrachten und kritisieren wie den seinerzeitigen. Nämlich als eine fortgeschrittene, hyperkonzentrierte Form kapitalistischer Ausbeutung – eine Form, die die Klassenherrschaft auf den Bereich von Daten, Algorithmen und Plattformmonopolen ausdehnt. Marx trat ja seinerzeit für die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln ein, nicht aber für deren Abschaltung oder Vernichtung: Im Sozialismus sollten die Produktionsmittel in den Besitz der Gesellschaft übergehen, d.h. sie sollten nicht mehr im Besitz des Kapitals sein, sondern kollektiv verwaltet werden. Eine solche sozialistische Wirtschaft sollte sich durch eine kollektive Planung und Kontrolle der Produktion auszeichnen.
Gälte es nicht, die Überwachungs-Produktivkraft analog dazu zu enteignen und in den Dienst eines planetaren Kollektivs namens Menschheit zu stellen? Gälte es nicht vielmehr, diese Überwachungsmaschinen unter unsere Kontrolle zu bringen, ihre gesellschaftlichen Potenziale auszuloten, ja sie sogar auszuweiten?
Wir können nicht zurück zu einem Kapitalismus, in dem nicht überwacht wurde – dem vor-informationellen –, sondern wir müssen ihn nach vorne auflösen. Die Überwindung des Überwachungskapitalismus kann nicht heißen, die Überwachung abzuschalten, sondern diese zu vergesellschaften. Denn wie die Ökonomin Sabine Nuss ganz richtig feststellt: „Daten hergeben zum eigenen Nutzen wäre gut, aber es ist oft zum eigenen Schaden.“ Aber tätig sein, Dinge herstellen, Daten generieren, die gepoolt zu gesellschaftlichem Nutzen, Mehrwert führen, das wollen wir!